„Updating Roland Barthes’ Mythologies“. Buchpräsentation und Runder Tisch
By Rosmarie Hagleitner
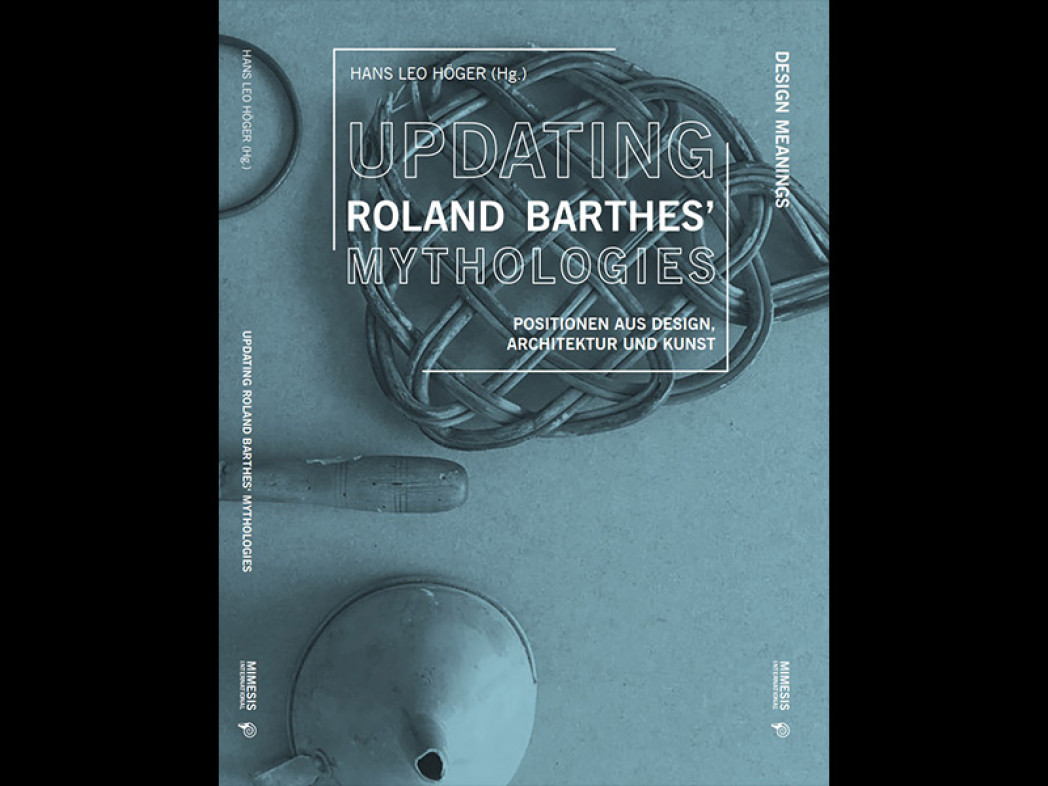
Vor 45 Jahren starb Roland Barthes, einer der einflussreichsten Kulturtheoretiker des 20. Jahrhunderts. Doch seine Analysen der Mythen des Alltags sind bis heute erstaunlich gegenwärtig – präzise, neugierig, kritisch gegenüber den scheinbar banalen Dingen. Der neue Sammelband Updating Roland Barthes’ Mythologies, herausgegeben von Hans Leo Höger, Professor für Theorie und Geschichte der Gestaltung und der Kommunikation an der Freien Universität Bozen, führt dieses Denken in die Gegenwart. Über 30 Autorinnen und Autoren aus Design, Architektur, Kunst und Kommunikationspraxis widmen sich solchen Mythen der Gegenwart: der Trinkflasche, dem Schweizer Taschenmesser, digitalen Phänomenen wie Instagram oder ChatGPT bis hin zu Demokratie und Nachhaltigkeit. Wie bei Barthes selbst sind die Beiträge kurz, analytisch und pointiert, sodass sie komplexe Phänomene des Alltags verständlich machen und zum Nachdenken anregen.
In Högers Buch wird auch deutlich, dass Gestaltung mehr ist als reine Formgebung: Sie ist eine Art des Denkens, Beobachtens und Fragens.
Herr Prof. Höger, Roland Barthes analysierte in den 1950er-Jahren Alltagsmythen, um die verborgenen Bedeutungen hinter scheinbar Selbstverständlichem sichtbar zu machen. Was hat Sie dazu bewegt, dieses Konzept in die Gegenwart zu übertragen?
Prof. Hans Leo Höger: Mir gefällt an Barthes, dass er die Welt mit einer intellektuellen Neugier betrachtet hat, ohne akademische Schwere. Er war ein „Leser der Welt“, kein Theoretiker im Elfenbeinturm. Diese Haltung wollte ich aufgreifen. Ich habe lange überlegt, ob ich – wie Barthes – alle Texte selbst schreibe. Aber mir wurde schnell klar: Heute braucht es viele Stimmen, um die Komplexität unserer Gegenwart sichtbar zu machen. So entstand die Idee, Autorinnen und Autoren, die im Bereich der Gestaltung tätig sind – also im Design, der Architektur und der Kunst – einzuladen, die aus ihren jeweiligen Perspektiven aktuelle Mythen untersuchen.
Was ist heute anders, was dagegen ähnlich geblieben?
Verändert haben sich teilweise die Mythen selbst. Streaming, Nachhaltigkeit, Algorithmen – Themen, die es zu Barthes’ Zeiten in dieser Form nicht gab, die aber ebenso viel über unsere Ideologien erzählen. Gleich geblieben ist die Freude am genauen Hinsehen, an der kleinen Beobachtung, die etwas über das große Ganze verrät.
Wie können Alltagsgegenstände Wissen formen oder weitergeben?
Zielgruppe dieses Buchs sind vor allem Gestalterinnen und Gestalter, allen voran Studierende. Und gerade für sie ist Qualität ein zentrales Thema. Ein Alltagsgegenstand kann uns viel darüber mitteilen, denn es geht nicht nur um Funktion oder Nachhaltigkeit, sondern um Qualität im umfassenden Sinn – im Material, in der Deutlichkeit einer Botschaft. In den Beiträgen in diesem Band wird diese Frage aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: etwa anhand eines vertrauten Objekts, das durch seine Beständigkeit überzeugt – wie das Schweizer Taschenmesser – oder durch den Blick auf Designgeschichte und darauf, wessen Arbeiten darin sichtbar werden – und wessen nicht. So entsteht ein vielschichtiges Verständnis von Qualität, das weit über formale Kriterien hinausgeht und auch den gesellschaftlichen und kulturellen Kontext mit einbezieht.
Wissen wird zunehmend durch schnelle, oft oberflächliche Meinungsäußerungen in digitalen Netzwerken ersetzt. Geht uns dadurch eine wesentliche Tiefe der Wahrnehmung verloren?
Was uns verloren geht, ist vor allem die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit – also die Bereitschaft, uns wirklich mit etwas zu beschäftigen, Hintergründe zu erkennen und über das Gesehene nachzudenken. Die allgegenwärtige Digitalisierung führt zu einer enormen Beschleunigung: Wir sind ständig mit Informationen konfrontiert und haben zugleich das Gefühl, nichts verpassen zu dürfen. Dadurch sinkt das Maß an konzentrierter, qualitativer Wahrnehmung. Sowohl Barthes’ Texte als auch die Beiträge in unserem Band heute sind eine Einladung, das Tempo herauszunehmen und sich mit bestimmten Phänomenen ein wenig eingehender zu beschäftigen, den Blickwinkel zu wechseln. Ein Beitrag beschreibt die Alltagsräume eines Menschen im Rollstuhl – eine Perspektive, die vielen von uns fremd ist und die uns eine neue Form der Aufmerksamkeit ermöglicht.

Ihr Band vereint Positionen aus Design, Architektur, Kunst, Kommunikations- und Kulturwissenschaft, aber auch aus Bereichen wie Nachhaltigkeit oder Medienpraxis. Warum ist Ihnen diese Interdisziplinarität so wichtig?
Interdisziplinarität spielt im Gestaltungsprozess eine zentrale Rolle – sie ist eigentlich unverzichtbar. Gestaltung betrifft Themen, die keine einzelne Disziplin allein bewältigen kann. Es reicht nicht, das passende Material zu kennen oder eine Form zu entwerfen; man muss auch verstehen, wie ein Objekt kommuniziert, welche Bedeutung es trägt und wie es wahrgenommen wird.
So überschneiden sich Produktdesign, Architektur und visuelle Kommunikation ständig. Hinzu kommen soziologische und psychologische Aspekte: Welche Dinge beschäftigen die Menschen heute, was prägt ihr Verhalten, ihre Werte? Genau diese Vielfalt wollte ich im Band abbilden.
Barthes schrieb in einer noch analogen Zeit, während wir heute in einer von digitaler Vernetzung geprägten Gegenwart leben. Was bleibt trotz der Beschleunigung unverändert faszinierend an den kleinen Dingen und Routinen in unserem Alltag?
Ich würde sagen, die Besinnung oder vielleicht auch manchmal die Rückbesinnung auf das Wesentliche. Damit meine ich nicht nur greifbare, physische Dinge, sondern auch eine persönliche Empfindungsebene: die Freude an kleinen Momenten des Alltags oder die Dankbarkeit für das, was uns selbstverständlich erscheint, es aber oft gar nicht ist. Diese Aufmerksamkeit für das scheinbar Selbstverständliche hilft uns, Dinge wirklich zu erfassen – und sie vielleicht in neuer Form in unser Leben zu integrieren. Solche Erfahrungen sind für mich vor allem analog, weil das Digitale immer eine vermittelnde Schicht zwischen uns und das Phänomen legt. Im direkten Kontakt – mit einem Gegenstand, einem Naturereignis oder einer Situation – entsteht eine unmittelbare Beziehung, die nicht gefiltert ist. Diese Haltung der aufmerksamen Beobachtung, die Roland Barthes schon in einer analogen Zeit gepflegt hat, bleibt für mich auch heute entscheidend: eine persönliche Auseinandersetzung mit der Welt, die über reine Analyse hinausgeht und Raum lässt für Empfindung, Position und Interpretation.
Der Sammelband Updating Roland Barthes’ Mythologies: Positionen aus Design, Architektur und Kunst von Prof. Hans Leo Höger wird am 9. Dezember um 18 Uhr in der Universitätsbibliothek am Campus Bozen Zentrum vorgestellt. Im Anschluss findet ein Runder Tisch statt mit Gesine Gold (Dipl.-Kommunikationsdesignerin mit Schwerpunkt strategischer Luxusmarken-Entwicklung und -Betreuung, Hamburg), Giorgio Camuffo (Grafikdesigner, Art Director, Ausstellungskurator, Professor für Visuelle Kommunikation an der Freien Universität Bozen), Ursula Schnitzer (Kunsthistorikerin, Ausstellungskuratorin, Autorin, Weberin, Meran), Renato Troncon (Professor für Ästhetik an der Universität Trient, Begründer und Mitherausgeber der wissenschaftlichen Buchreihe "Design Meanings"), Kuno Prey (Produktdesigner, Ausstellungskurator, Buchautor, Gründungsdekan der Fakultät für Design und Künste an der Freien Universität Bozen), Hans Leo Höger (Herausgeber des Buches und Initiator des gleichnamigen Forschungsprojekts).
Related people: Hans Hoeger, Kuno Prey